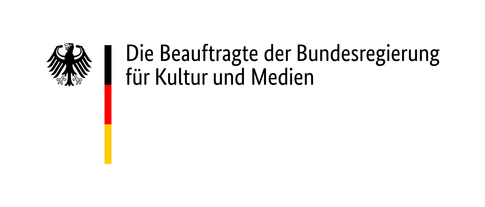Handpuppenkunst zwischen Satire, Tragik und menschlicher Erkenntnis
Iokaste spielt als Mutter und Gattin der männlichen Hauptfigur Ödipus eine entscheidende Rolle im Familiendrama „Ödipus Tyrannos“ des antiken griechischen Tragödiendichters Sophokles. Zu Beginn des Stücks erscheint Iokaste als ruhige und ausgeglichene Figur, die versucht, den Streit zwischen Ödipus und ihrem Bruder Kreon zu schlichten.
Nach und nach erkennt sie als erste der Hauptcharaktere das schreckliche Ausmaß der verschiedenen Stränge an Ereignissen, die dem Handlungszeitpunkt vorausgehen, und die fatale Wahrheit hinter dem berühmt berüchtigten Orakelspruch, den ihr erster, inzwischen verstorbener Gatte Laios empfangen hatte. Das Orakel von Delphi hatte ihm verheißen, dass sein Sohn ihn töten und seine Frau ehelichen würde.
Diese Erkenntnis stürzt sie in tiefste Verzweiflung, sodass sie ihrem Leben ein Ende setzt und damit die Tragödie ihres Sohnes und Mannes endgültig besiegelt.

Handpuppe: Iokaste aus "König Ödipus" von Gottfried Reinhardt (1974), Kopf und Hände aus Papierkaschur, kaschiert und bemalt; Kleid aus Baumwolle; Kragen aus Mischgewebe, 65 x 22,5 x 9 cm
© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Puppentheatersammlung (Inv.-Nr.: A 10554), Foto: Jacob Franke
Bei Gottfried Reinhardt (1935–2013) wird die Iokaste in einer grotesken Adaption des Stoffes zu einer doch eher eindimensionalen Figur, die vor allem auf einen neuen Ehemann aus ist. Als sie erfährt, dass ihr Mann Ödipus auch ihr Sohn ist, erhängt sie sich, wie auch in der antiken Tragödie von Sophokles. Der Kasper als allwissender Erzähler kommentiert:
Da hängt sie nun an ihrem Faden,
als Folge schlimmer Taten.
Ihr seht das unbefangen an,
weil ihr nicht wisst, dass euer Glück
an dünn’rem Faden hangen kann.
(Kasper in „König Oedipus“ (1974) von Gottfried Reinhardt)

Gottfried Reinhardt 2007 in seiner Bühne
© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Puppentheatersammlung, Foto: Frank Höhler
Das Stück endet mit einem Monolog der mysteriös auftretenden Sphinx, der über das Wesen des Lebens, die Suche nach dem Sinn und die Widersprüche der menschlichen Existenz reflektiert, und mit einem eindringlichen Appell des Kaspers, die Komplexität und Unberechenbarkeit der menschlichen Natur anzuerkennen. Das Theater wird dabei zu einer Metapher für die Welt, eine Bühne des Wandels und der Unsicherheit, die aber auch Raum für Stabilität und Orientierung bietet, sofern der Mensch bereit ist, sein inneres Gleichgewicht zu bewahren: „Lasst Ihr Euch nicht erschüttern, auch wenn eure Häuser wie dieses erzittern!“ ermahnt die Figur des Kaspers.
Reinhardt fordert das Publikum auf, sich mit den Grundfragen des Lebens auseinanderzusetzen, ohne sich jedoch von der rastlosen Suche nach Antworten oder der Angst vor ungelösten Rätseln lähmen zu lassen. In diesem Sinne wird das Stück zu einem Aufruf, die Ungewissheiten des Lebens nicht als Bedrohung, sondern als integralen Bestandteil der menschlichen Erfahrung zu begreifen.
Reinhardt, der zunächst als Bühnenbildner und Ausstatter für verschiedene sächsische Theater und das DEFA-Trickfilmstudio in Dresden gearbeitet hatte, entdeckte erst mit Ende 30 seine Leidenschaft für Handpuppen. An seiner eigens gegründeten Puppenbühne übernahm er alle kreativen Prozesse selbst, von der Gestaltung der Figuren und Kulissen bis hin zu Text, Regie und Spiel. Er verstand sich als Freigeist, für den ein selbstbestimmtes Leben von höchster Bedeutung war. Seine kompromisslose Eigenständigkeit äußerte sich in der vollständigen Kontrolle, die er über jedes Detail seiner künstlerischen Arbeit ausübte.

Reinhardts meist mehrdeutige Inszenierungen spiegelten seine tief verwurzelten Überzeugungen und persönlichen Ansichten wider, die nicht nur gesellschaftlich relevante Themen aufgriffen, sondern auch seine Kritik an Obrigkeiten und Institutionen sowie seine Liebe zur Natur und den Tieren zum Ausdruck brachten – stets bewusst abseits der offiziellen Kulturszene der DDR.
Da ihm die Anerkennung als professioneller Puppenspieler zunächst verweigert wurde, zeigte er seine Werke vor allem im privaten Umfeld, beispielsweise in Wohnzimmern, künstlerischen Ateliers oder auch in Räumen der Kirche. Sein Repertoire reichte von griechischen Tragödien, Märchen der Gebrüder Grimm und Dramen der Weimarer Klassik über musikalische Adaptionen, wie etwa von Mozart, bis hin zu eigenen, höchst fantasiereichen Stücken.
Auch interessant:
Puppentheater und Trickfilm haben viel gemein. Eine dieser Gemeinsamkeiten ist Lotte Reiniger, die einerseits maßgebliche Pionierin des frühen Trickfilms und seiner Techniken gewesen ist und andererseits unentwegt auch die Welt des Schattentheaters mit ihren Scherenschnitten bereicherte.

Was sich zu Unfug erklärt, bekennt sich zur Harmlosigkeit. Vermeintlich. Denn Konsequenz solcher Selbstbestimmung ist die berühmte Narrenfreiheit, die in den 1980er Jahren auch eine Gruppe von Theaterleuten in der DDR für sich beansprucht, als sie sich „Zinnober“ nennt und beginnt, Kaspertheater für Erwachsene zu machen. Ihr Stück „Die Jäger des verlorenen Verstandes“ ist vom Publikum unschwer als Spottstück auf das DDR-Staatswesen zu lesen und seine Duldung in der Rückschau kaum zu glauben - aber wahr.
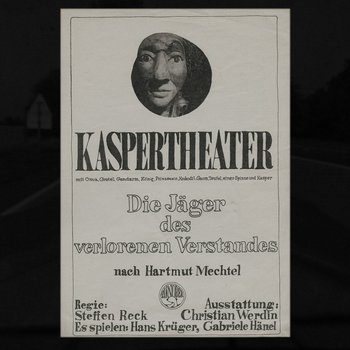
Fischer und Bäuerinnen, Musiker und turnende Kinder, aber auch Enten, Wasserbüffel, Drachen und Feen - sie alle gehören zum klassischen Personal des vietnamesischen Wasserpuppentheaters. Direktorin Kathi Loch über eine sehr besondere und im wörtlichen Sinne bunte Truppe, die im Frühjahr 2020 in das Depot der Puppentheatersammlung einzog.