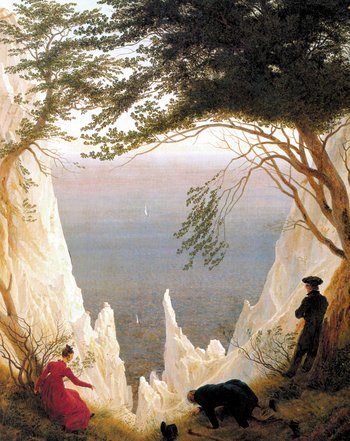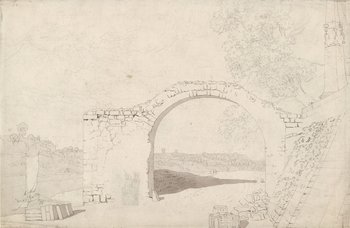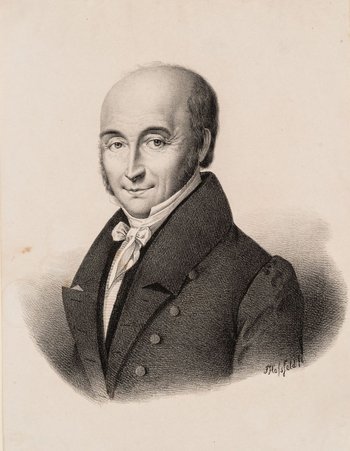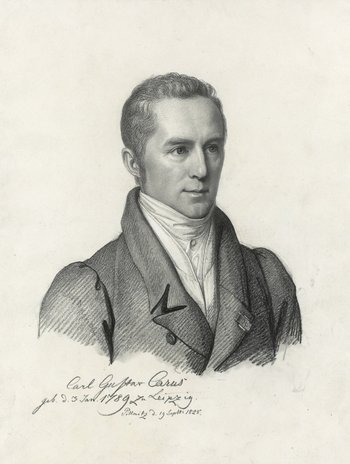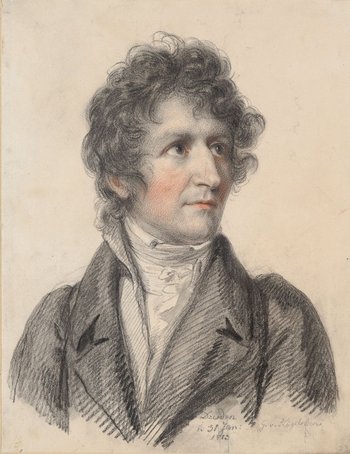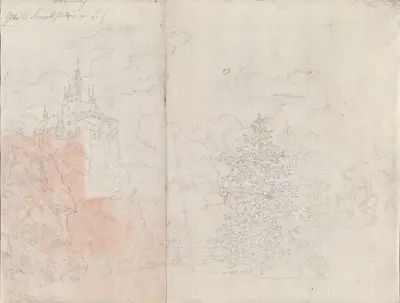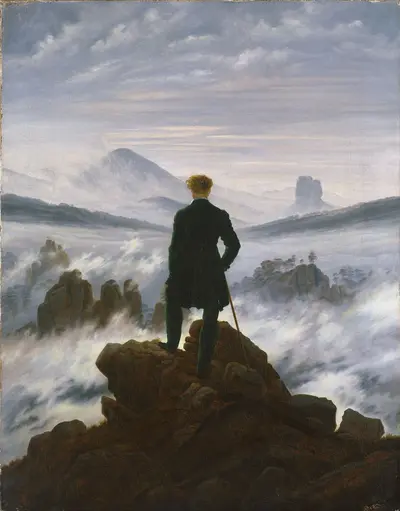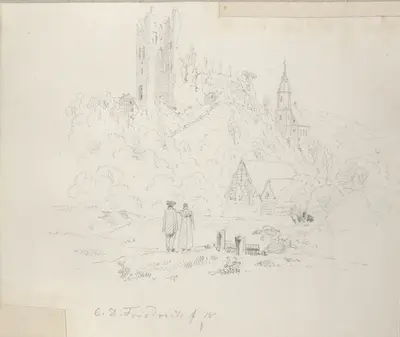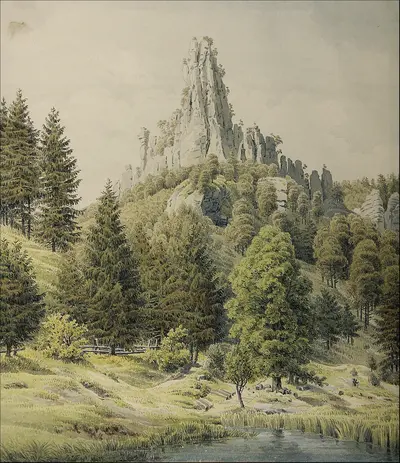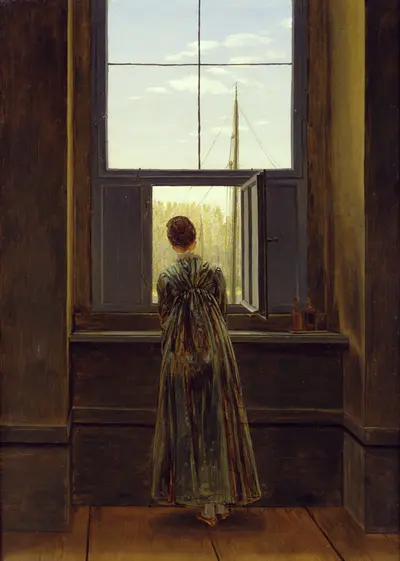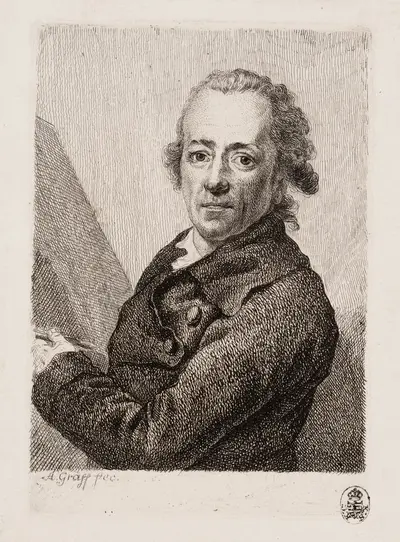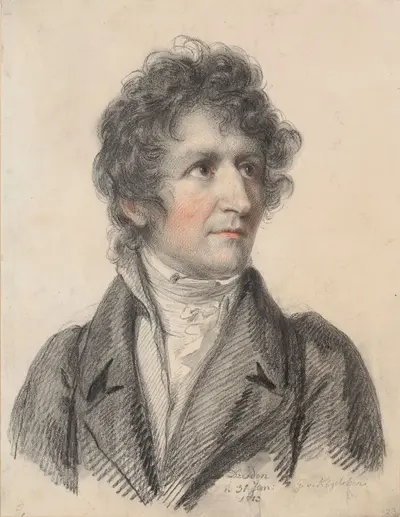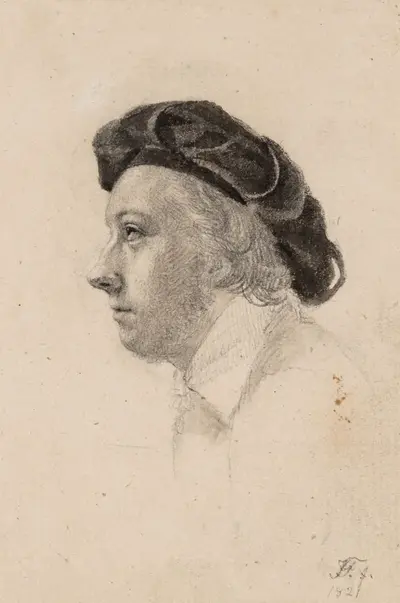Alle Orte zu besuchen und zu verzeichnen, die in Friedrichs Werk vorkommen, ist natürlich nicht möglich, sodass Sie auf dieser Karte eine Auswahl von Motiven finden, die sich vor allem auf den Raum Dresden und Umgebung sowie Rügen konzentriert. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Friedrich freilich auch noch an vielen anderen Orten gezeichnet hat, insbesondere der Gegend um seine Geburtsstadt Greifswald oder um Kopenhagen, wo er in den 1790er Jahren studierte. Auch die Motive seiner Reisen in den Harz, das Riesengebirge oder durch Brandenburg sind auf dieser Karte aktuell nicht lokalisiert, so wie vieles, was er in Sachsen und Böhmen gezeichnet hat. Wir hoffen, dieses Format zukünftig weiter anreichern zu können. Sie können dabei helfen, indem Sie diese Orte selbst aufsuchen und uns Ihre Bild- oder gar Filmbeiträge einsenden. Wenden Sie sich dafür gern an die E-Mail-Adresse ganz unten in diesem Impressum.
___
Konzeption: Holger Birkholz, Jacob Franke, Petra Kuhlmann-Hodick
Es sprechen: Holger Birkholz, Peter Dänhardt, Frank Richter, Hannes Knapp, Katja Paul und Marius Winzeler
Film/Text: Jacob Franke
Übersetzungen: Valentin Sebastian Lorenz
Technische Umsetzung und Betreuung: XIMA Media GmbH
Wir bedanken uns an dieser Stelle darüber hinaus bei: Diana Edkins, Birte Frenssen, Andreas Harvik, Jan Nicolaisen, Annett Reckert, Sabine Schmidt, Ines Stephan und bei Schlösserland Sachsen sowie dem Fremdenverkehrsbetrieb Oybin.
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Friedrich-Kennern Frank Richter und Hannes Knapp, ohne deren Kenntnis der Sächsischen und Böhmischen Schweiz beziehungsweise Rügens sowie der Präsenz dieser Regionen im Werk Friedrichs dieses Format nicht denkbar gewesen wäre.